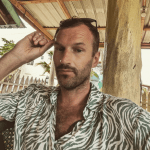Basic Income for Nature & Climate
Grundeinkommen, Klimaschutz und Biodiversitätserhalt
Das Grundeinkommen für Natur und Klima (BINC) ist ein neuer Mechanismus zur Finanzierung von Aktivitäten zur Erhaltung der Biodiversität und zur Minderung des Klimawandels. Der BINC-Vorschlag kombiniert grundlegende Prinzipien des Grundeinkommens (BI) mit Umweltzielen und zielt darauf ab, die Biodiversität zu schützen und den Klimawandel zu mindern, während soziale Ungleichheit verringert wird. BINC bietet regelmäßige Zahlungen an Gemeinschaften in der Nähe oder innerhalb kritischer Schutz- oder Klimaregionen, um Lebensgrundlagen zu unterstützen und ihre Abhängigkeit von ausbeuterischer und nicht nachhaltiger Ressourcennutzung zu verringern. Um traditionelle Praktiken zu schützen, neue nachhaltige Nutzungen von Waldressourcen zu fördern und/oder zu incentivieren und gleichzeitig Freiheit bei der Wahl alternativer Entwicklungswege zu ermöglichen, glauben wir, dass neue Finanzmechanismen für die Bewohner dieser Regionen notwendig sind. In diesem Zusammenhang könnte das Grundeinkommen eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Bewirtschaftung kritischer Ökosysteme spielen.
Warum BINC? Wie funktioniert es?
BINC ist ein von Menschen geleiteter Ansatz. Es erkennt an, dass für Gerechtigkeit eine wesentlich größere Umverteilung von Ressourcen zwischen denen erforderlich ist, die historisch mehr genommen haben und mehr Schaden verursacht haben, und denen, die weiterhin unter den Ungerechtigkeiten leiden, die aus der Ausbeutung der Umwelt resultieren. Es kann als eine Form der Entschädigung für die unbezahlte Arbeit betrachtet werden, die viele ländliche Gemeinschaften den Aktivitäten widmen, die zu Schutzergebnissen auf den von ihnen kontrollierten Gebieten beitragen. Durch Reduzierung der Aufsicht, Bürokratieabbau und Umgehung von Zwischenhändlern stärkt BINC lokale Gemeinschaften und strafft die Finanzierung. Im Gegensatz zu aktuellen und populären marktbasierten Instrumenten (MBIs) ist BINC ein Instrument der sozialen Gerechtigkeit.
Ausblick: Skalierung von BINC für eine gerechte und nachhaltige Zukunft
Obwohl BINC kein Allheilmittel ist, stellt es bei weitem den skalierbarsten Mechanismus dar, um die Polykrise des Klimawandels, des Verlusts der Biodiversität und der Ungleichheiten anzugehen. BINC ist Teil eines breiteren und umfassenderen Programms für transformativen Wandel, das auch extraktive Industrien umfasst, die auf lokale Schutzräume zugreifen, und die Schaffung verbesserter Governance-Rahmenwerke und Richtlinien, um diese Bedingungen zu ermöglichen. Diese müssen die Formalisierung von Land- und Besitzrechten für indigene Völker und lokale Gemeinschaften umfassen, da viele von ihnen auf Land leben, das bereits zu Schutzergebnissen beiträgt und/oder rechtlich geschützt und von der Umwandlung des Landes ausgeschlossen ist.
Der nächste Schritt besteht darin, aus bestehenden BINC-Projekten zu lernen und dieses Wissen zu nutzen, um BINC-Projekte an anderen Standorten und in größerem Umfang zu replizieren. Dies sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern geschehen, geleitet durch transdisziplinäre Forschung, die wirtschaftliche, ökologische und soziologische Methoden integriert. Dieser Ansatz wird Erkenntnisse liefern, um Projekte anzupassen und zu verbessern, während ein skalierbares Modell und Best Practices entwickelt werden. Während wir daran arbeiten, die Finanzierung von Schutz- und Klimamaßnahmen zu transformieren, um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern, laden wir Spender und Partner ein, sich uns anzuschließen und diesen innovativen Ansatz durch die Umsetzung von Pilotprojekten für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft zu erproben.
Wie könnte ein globales BINC-Programm finanziert werden?
Eine zentrale Herausforderung für BINC besteht darin, nachhaltige Finanzierung zu sichern, ohne sich auf globale Umweltmärkte zu verlassen. Forscher haben geschätzt, dass die weltweite Finanzierung von BINC je nach Anzahl der Empfänger und Höhe der Zahlungen weltweit zwischen 351 Milliarden und 6,73 Billionen USD jährlich kosten würde. Diese Summen liegen bereits gut innerhalb des Rahmens dessen, was voraussichtlich benötigt wird, um den globalen Schutz und die Klimaschutzaktivitäten in Zukunft zu erweitern. Es wird geschätzt, dass zwischen 1/3 und 1/4 des gesamten Weltvermögens in Offshore-Steueroasen verborgen ist. Die globalen Subventionen für umweltschädliche Aktivitäten wie fossile Brennstoff- und konventionelle Landwirtschaftsproduktion werden auf 2,6 Billionen USD pro Jahr geschätzt. Wenn auch nur ein kleiner Teil dieser Mittel auf BINC umgeleitet würde, könnte es leicht die Umsetzung eines umfassenden internationalen Programms finanzieren. Konkrete Finanzierungsquellen für BINC wurden vorgeschlagen, wie die Verknüpfung mit Klimaschutzmaßnahmen durch das Konzept einer Waldkohlendividende oder einem von der Cap and Share Alliance vorgeschlagenen „Cap and Share“-Mechanismus.
Wie FRIBIS beiträgt
Die BINC-Arbeitsgruppe ist eine gemeinsame Initiative zwischen FRIBIS und Forschern an der Autonomen Universität Barcelona (Spanien), der Florida International University (USA), der Universität Freiburg (Deutschland), der UIII – Indonesian International Islamic University (Indonesien), der Wageningen University (Niederlande) und der York University (Kanada) sowie der Entwicklungshilfeagentur GIZ (Deutschland) und den NGOs Cool Earth (Peru, Großbritannien), GiveDirectly (Deutschland, Großbritannien) und WCS (Kambodscha).
Weitere Forschungen werden bei FRIBIS durchgeführt, um die Machbarkeit verschiedener BINC-Pilotprojekte zu erkunden, um deren Auswirkungen auf Lebensgrundlagen und Natur zu testen. FRIBIS bietet wissenschaftliche Expertise, finanzielle Unterstützung und erleichtert die Interessenvertretung und politischen Dialoge des vorgeschlagenen Grundeinkommensschemas auf internationaler Ebene. Das langfristige Ziel unseres Teams ist die Umsetzung eines mehrjährigen BINC-Projekts in großer Skalierung unter Nutzung der Expertise der Mitglieder, die unsere Gruppe bilden.
Mehr über „Grundeinkommen für Natur und Klima“ erfahren Sie hier:
- Mumbunan S., Maitri, N.M.R., Tazkiana, D., Prasojo, A., Sihite, F., Nabella, D.M. (2021). Basic Income for Nature and Climate. On the first Basic Income proposal to conserve nature and combat climate change on the largest tropical island on Earth. Depok: Research Center for Climate Change Universitas Indonesia. (ISBN 978-602-60534-3).
- Schmidt-Pramov, F. (2021). A basic income for nature and climate in Tanah Papua. Berlin: GIZ. (Policy Brief).
First Basic Income for Nature and Climate report here [videos, available in Indonesian only].
FRIBIS Team Koordinator

Kontakt: marcel.franke@vwl.uni-freiburg.de
Research Team

Er lebt in Jakarta, Indonesien.
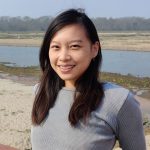



Transfer Team




Assoziierte Mitglieder